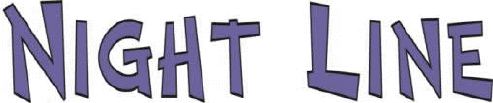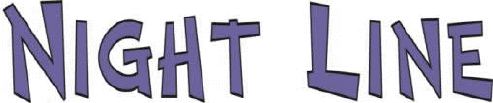|
Der
Liebesbrief
In
der Winterdämmerung zog der singende Krähenschwarm nach Osten. Das
Schauspiel der schwarzen Schemen fand von Nacht zu Nacht seine
Fortsetzung. Der Flug führte die Tiere aus dem Kahlenberger
Friedhof in den Augarten herüber, um sie mit der aufgehenden Sonne
wieder in den Westen hinüberzuführen.
Ihr Schlafplatz konnte nicht derselbe Ort sein, wo sie den Tag
zubringen wollten; warum dies so war, blieb rätselhaft: Die Wiesen
und Eichen des Augartens böten ihnen genug Nahrung und Schutz.
Es mag der Instinkt der Zugvögel gewesen sein, stupide Gewohnheit
oder – jenseits biologischer Logik – das atmende Wintergemälde,
das sie Menschenohren und Menschenaugen schufen.
Unter einem der Dächer war eine junge Frau ungesehen und ungehört
dabei, Dinge zu verrücken und danach deren ursprünglich
vorgefundene Position akribisch wiederherzustellen.
Milli begann damit, Pauls Hemden von den Stuhllehnen zu klauben. Sie
sog seinen Geruch ein, ängstigte sich, er könnte in diesem Moment
wieder nach Hause kommen, und legte die weichen Hemden zurück auf
ihren Platz.
Dann riss sie Tischladen auf, durchforstete sie mit Fingerspitzen
nach neuen Notizen, nach aufgerissenen Zigarettenpackungen, die ihr
mehr über Paul erzählen würden.
Sein Tagebuch fand sie diesmal hinter den staubigen Schuhen am Boden
des Kleiderschranks. Sie versuchte sich seine exakte Lage einzuprägen,
nahm es dann hervor und schlug es am Fußboden hockend auf.
Der Eintrag zum vergangenen Tag war wieder knapp und die darin
aufgelisteten Informationen sprachen nicht von Gefühlen. Es war ein
ständiges „Will wieder E.G. Craig lesen“ - „Ich habe die
Aussicht, in Harper’s Bazaar zu veröffentlichen“ – „Philips
Performance war langweilig und altbacken“.
Milli riss alles wahllos an sich, jeden Schnipsel seiner Existenz.
Da, als letzten Satz:
„Den Liebesbrief geschrieben.“
Die Aussicht auf ein solches Geschenk ließ ihre Hände zittern, als
sie Pauls Tagebuch an seinen Platz zurückstellte und betete, er würde
auch diesmal nicht bemerken, dass sie es gelesen hatte.
Bald wurde es so warm, dass sie gemeinsam im Wintergarten frühstücken
konnten, bevor die Kälte wieder zurückkehren würde.
Paul fragte sie sanft, vielleicht doch ein wenig verstimmt: „Wie
schaut dein Tag aus?“
Zum tausendsten Mal wünschte sie sich, immer zu wissen, was er
dachte. Sie strich mit ihren nackten Zehen über die am Fußboden
liegende Hündin und erzählte etwas über zu erwartende Überstunden,
bis wieder Stille einkehrte. Milli verbiss sich darin, glücklich zu
sein, weil er da war.
Paul betrachtete ihr schönes Gesicht, konnte sich nicht satt sehen
daran, dass ihr Schlafrock eine Schulter mehr frei ließ als die
andere, und genoss dankbar die Atmosphäre aus provokanter
Entspannung und legerer Leidenschaft. Er dachte daran, dass er Milli
wohl von ganzem Herzen liebte.
Sie gestattete seine Blicke, indem sie ihm in die Augen sah.
Er hasste den Moment der Unsicherheit, als seine Augen nicht mehr
standhielten und er wegsehen musste. Das Abwenden von ihr musste
etwas mitteilen, was er nicht sagen wollte.
Die Krähen waren über das Glasdach hinweggezogen und Milli warf
einen Blick auf seine Armbanduhr.
Eine Woche war vergangen, seitdem Milli begonnen hatte, auf Pauls
Brief zu warten. Es sollte für sie der Beginn einer Arbeitswoche im
Antiquariat nach drei im Ausland verbrachten Tagen sein, in denen
Paul kaum wirklich gearbeitet und stattdessen mit ihr Alkohol– und
Leidenschaftsexzesse im Hotelschlafzimmer veranstaltet hatte.
Die Rückkehr nach Wien war entsetzlich, Milli war übel, ihr ganzer
Körper schmerzte und es drängte sie nach einer Antwort.
Gab es eine andere Empfängerin des Briefes als sie?
Es verwirrte sie nur noch mehr, dass ihr Geliebter den Brief als
unzureichend empfunden und einfach weggeworfen oder dass er mit der
Bezeichnung „Liebesbrief“ etwas geheimnisvolles Anderes gemeint
haben könnte. Doch sie kannte von ihm weder schreiberisches Unvermögen
noch Ironie.
Fehlten Briefmarken in seiner Schreibtischschublade, ein Kuvert,
waren noch Druckspuren auf einem Schreibblock zu finden?
Milli fühlte sich fiebrig, schmutzig, hilflos. Sie hasste sich dafür,
wie sie war.
Sie stöberte in Papierkörben, rannte mit seinem aufgeschlagenen
Tagebuch in der Wohnung umher und stellte sich vor, die bewegten
Schatten, die die Morgensonne von ihr an die Wand warf, wären seine
und könnten ihr Antwort geben.
Er war fort, er hatte den Hund von ihrer Schwester abgeholt und saß
nun im Café Weimar in der Porzellangasse. Ab und zu nippte er
nebenher an der Kaffeetasse und konzipierte am Notebook einen
Artikel.
Es ging um eine Pariser Großausstellung mit Übermalungen von
Arnulf Rainer, nein, es musste um einer Verlagerung der Lesart von
Rainers Kunst gehen. Als Haupttitel könnte er sich „The death of
meta-communication“ vorstellen, da er auf ein Abgehen von der
Interpretation der Übermalungen als einer Verdeutlichung inhärenter
Linien und Dynamiken des ursprünglichen Bildes abzielen wollte und
stattdessen die Suche nach der Direktheit des unmittelbar ästhetisch
erlebbaren Bildes hinter der Übermalung als einer mythischen
Sehnsucht, die Rainers Kunst in Wahrheit ausmachte, vorschlagen
wollte.
Sein kleiner Hund gefiel ihm, wie er so auf dem Stuhl neben ihm lag.
Paul streichelte sein Fell und stellte fest, dass es ihm nicht
gefiel, wie ihm die Haut an den Lefzen herunterhing. Die Tendenz
ikonographischer Überlagerung im kunstgeschichtlichen Diskurs
musste ausgeklammert werden.
Er sollte endlich anfangen, auf Englisch zu denken.
Besser als die Lefzen seines Hundes gefiel Paul die Innenseite von
Millis Vagina. Sie war nicht rot, sondern rosa, appetitlich und
zart; sie war die begehrenswerteste, die er kannte.
Das war die Idee, die über eine Ausstellungsreportage hinaus
propagiert werden sollte – die Freiheit des Betrachters, bei
Arnulf Rainer.
Später, als Paul das Café Weimar längst wieder verlassen hatte,
fand Milli den Liebesbrief. Er lag in Pauls Aktenkoffer und war
zerknittert.
„Du!“ war das erste Wort, und bevor Milli weiterlas, eilte sie
in die Garage und fertigte mit dem Kopierer ein Duplikat an.
Der Brief war mit der Hand geschrieben worden, allerdings musste es
sich bereits um eine Reinschrift handeln, da nirgends Streichungen
und Verbesserungen zu sehen waren und das, was Paul hier verfasst
hatte, von untadelhafter Schönheit und Raffinesse war.
Milli zweifelte, ob sie es in Anspruch nehmen durfte, mit diesem
„Du!“ gemeint zu sein. Nichts in dem Brief bezog sich auf
gemeinsam Erlebtes, doch er ging über diese Stufe hinaus und erzählte
von der Liebe in den weitläufigsten und zugleich intimsten Bildern.
Der Brief zwang die Leserin zu umfassender Liebe: Sie musste den
Verfasser und das Blatt Papier dafür lieben, dass Milli nach der
Lektüre jener sich an sie richtenden, sanft in ihr verkriechenden
Worte sich selbst lieben musste.
Es war mit der Zeit nicht mehr wichtig, ob Paul den Brief wirklich
an sie geschrieben hatte, ja Paul selbst verlor an Bedeutung.
Solange sie allein war, beschäftigte sich Milli weniger verzweifelt
als früher mit ihm. Zwar las sie noch heimlich in Pauls Tagebuch,
doch mehr aus Gewohnheit als auf der besessenen Suche nach etwas -
in welcher Weise auch immer - Bestürzendem.
Wenn Paul für eine oder zwei Wochen ohne sie ins Ausland fuhr,
unternahm Milli das Ritual, Ausschnitte aus dem Brief über das
ganze Haus verteilt an leeren Wänden anzubringen. Wann immer sie in
sich zusammen zu sinken drohte, suchte sie einen der Sätze auf und
wuchs wieder in ein Lächeln hinein.
Jeweils bevor Paul zurückkehrte, entfernte sie alles, wobei sie
Acht geben musste, die Papiere nicht an einer Stelle aufzubewahren,
an der Paul sein Tagebuch verstecken würde.
Nur selten fragte sich Milli, ob Paul längst wusste, dass sie an
den Liebesbrief herangekommen war, ja es durch seine
Tagebucheintragung darauf angelegt hatte, dass sie ihn finden würde.
Es war an einem kalten Märzabend und Paul ging mit der Hündin im
Augarten spazieren. Ob es klug gewesen war, das Tier hierher zu
bringen, wo Tausende Krähen auf die schneeweißen Wiesen verstreut
vor dem Schlafengehen mit den Flügeln klapperten, klärte sich
bald.
Obwohl sie an einer Laufleine hing, stürzte sich die Hündin hinter
eine immergrüne Hecke.
Paul hörte sie bellen, einen Vogel schreien, und zog an der Leine,
als wollte er jemanden erwürgen. Ihm blieb nichts übrig, als
selbst hinter die Hecke zu treten.
Dort sah er im Schnee eine Krähe, der ein Flügel fehlte, die
blutete und in immer weiter gezogenen Kreisen umherlief, aber nicht
mehr schrie.
Sie würde bei Tagesanbruch nicht mehr über die Dächer zum
Kahlenberger Friedhof fliegen können.
In der schwer erträglichen Kälte, mit seinen müden Beinen fühlte
sich Paul seltsam betroffen, er fühlte sich verantwortlich.
Er ließ sich auf eine vereiste Parkbank unter einer Laterne fallen
und nahm aus seiner Jackentasche den Liebesbrief, der Trost spenden
und glücklich machen sollte.
Er hatte ihn an sich selbst geschrieben.
|